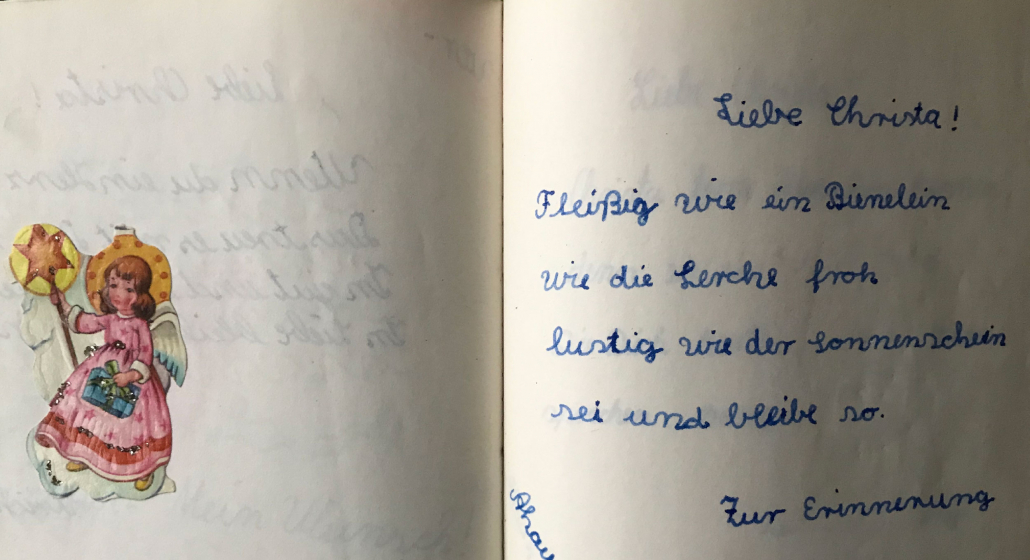Die Dame rechts neben mir war empört. „Wenn ich mit dem Auto nicht mehr in die Stadt fahren kann, dann gehe ich eben woanders hin.“ Dass es vielleicht eine bessere Bustaktung geben könnte in Zukunft, flotte Leezen-Kuriere, die den Einkauf nach Hause bringen, brachte sie nicht zum Nachdenken. Der Herr am anderen Ende des Tisches schloss sich an: „Ich sehe gar nicht ein, warum ich auf irgendetwas verzichten sollte.“ Natürlich braucht es kluge Konzepte für Mobilität, für Auto- und Fahrradverkehr, für Busse und (Zukunftsmusik?) S-Bahn im Münsterland, natürlich stehen wir vor größten Herausforderungen, potenziert durch pandemische krisenhafte Zeiten. In Münster liegen die großen Zukunftsthemen auf dem Tisch, alle, die Lust haben, können sich beteiligen und ihre Ideen einbringen zu unserem Leben in der Stadt, zur Zukunft von Wohnen, Innenstadt & Co, von Wissensquartieren und starker Wirtschaft und vor allem, wie werden alle Menschen mit ihren so unterschiedlichen Interessen mitgenommen.
Während die Empörungs-Sätze von Ü-60-Jährigen über den Kaffeetisch flogen, dachte ich an die junge Studentin, die auf warmes Wasser verzichtet und kalt duscht. Nicht als Kneipp’sche Anwendung, sondern weil sie ganz persönlich überall Energie spart, wo es nur geht. Für diese Welt. Weil sie sich persönlich verantwortlich fühlt.
Ich glaube nicht, dass die großen Themen, die wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen, Generationen-Konflikte sind. Auch innerhalb jeder Generation sind die Interessen sehr vielfältig. Jedes einzelne Thema ist so komplex, dass soziale, wirtschaftliche, ökologische Fragen gleichermaßen aufgeworfen werden. Aber wie wir leben und gestalten, das ist eine Frage, die Generationen beeinflusst.
Von meiner 85-jährigen Mutter wollten wir vor ein paar Tagen beim Sonntagskaffee noch mal die Geschichte vom Kriegsende hören: Die alliierten britischen Soldaten machten wahrscheinlich große Augen, als sie Mutter und Kind plötzlich im Türrahmen sahen. Meine Oma mit der kleinen Marlies, einem Mädchen von damals sieben Jahren. Frühjahr 1945, die britischen Befreier hatten sich gerade ins Haus meiner Großeltern einquartiert, während meine sehr unerschrockene Oma die drei kleineren Kinder bei der Großtante in einem benachbarten Dorf untergebracht hatte. Mit der kleinen Marlies – meine Mutter war das älteste Kind – wollte sie partout nach dem Rechten sehen und traf auf die Soldaten.
Bis heute behauptet meine Mutter, dass sie als Kind im Krieg überhaupt keine Angst kannte. Aber dass sie als kleines Mädchen kilometerweite laufen musste, um zu „hamstern“, ein bisschen Milch für den kleinen Bruder zu bekommen, im Wald Bucheckern zu sammeln, auf dem Feld die Ähren aufzulesen. Partout wollte sie später in keiner Warteschlange stehen, so sehr wirkte das Anstehen mit den Lebensmittelmarken nach.
Warum ist es so wichtig, dass wir unsere Geschichten erzählen? Die aktuellen, die alten Erzählungen. Weil wir die großen Themen über die Geschichten, über die Gefühle besser verstehen. Weil Vertrauen entsteht. Ohne Vertrauen funktioniert Demokratie nicht. Weil wir sehen, was aus Mut und Experimentierfreude wachsen kann.
Jedes Thema hat eine Fülle von Aspekten, über die wir als Gesellschaft sprechen müssen: Wohnen, Mobilität, Arbeit, Digitalisierung und Smart City, Nachhaltigkeit und Klima. Wissenschaft und eine innovative, zukunftsstarke Wirtschaft. In krisenhaften Zeiten ist der Wunsch nach einfachen Antworten groß. Die gibt es aber nicht. Gewiss ist die Ungewissheit.
Mir fallen die Geschichten meiner Eltern aus ihrer Kindheit und Jugend ein, weil Erzählungen auch im politischen Diskurs in diesen krisenhaften Zeiten so wichtig sind. In vielen Zusammenhängen haben wir das Streiten ja verlernt. Damit meine ich nicht, die eigene Position und Meinung zu verteidigen. Sondern wirklich verstehen zu wollen: Warum denkt mein Gegenüber so? Was bewegt ihn wirklich? Kann ich zuhören? Ein Streiten, bei dem aufgeatmet wird, weil ich von meinem Gegenüber etwas erfahren, neue Erkenntnisse gewonnen habe. Weil ich trainiere, frei und kreativ zu sein, Vorurteile zu überwinden.
Ganz schön schwer in pandemischen Krisenzeiten, in der alle über jeden Moment von Leichtigkeit froh sind. Ganz schön schwer, wenn sich alle nach Gewissheiten, Eindeutigkeiten und Verlässlichkeiten sehnen und versuchen, den Alltag zu meistern oder um ihre Existenz kämpfen. Und zum Reden braucht man Zeit, man braucht die Nerven und Geduld.
Was sind schon Gewissheiten, wenn das Leben weitgehend in der eigenen, weitgehend akademischen „Bubble“ stattfindet. Wer nicht gerade im sozialen oder pädagogischen Bereich oder in der Kultur arbeitet, bekommt die Geschichten nicht mit oder sieht morgens nicht, dass Kinder ohne Frühstück in die Kita oder in die Schule kommen. Als ich vor Jahren hörte, dass Kinder aus Stadtteilen noch niemals am Prinzipalmarkt oder Aasee waren, habe ich es das nicht für möglich gehalten. Dass es im großen Maße gelungen ist, Kräfte gegen die Kinderarmut zu mobilisieren, dass es heute Stadtteilkoordinatoren gibt, die wie Seismographen aufspüren, ob die Kinder und deren Familien Zugang zu den richtigen Angeboten und Hilfen bekommen.
Die inzwischen berühmte Oodi-Bibliothek in Helsinki ist so ein Wohnzimmer der Stadt, eine „Hommage an die Gemeinschaft“. Jugendliche stehen am 3-D-Drucker, Kinder spielen, in jeder Ecke Sessel oder Arbeitsplätze, Bastel- und Elektronik-Labore, Co-Working-Spaces, alte Damen beim Stricken, Mädchen an den Nähmaschinen. Mein Mann, der einige Jahre in Finnland gelebt hat, erinnert sich daran, wie teuer Bücher dort waren und dass es im kleinsten Dorf eine große Selbstverständlichkeit war, Bücher auszuleihen und in der Bibliothek zu verweilen. Schöne Vorstellung für Münster: Statt eines Cafés im alten Stadthausturm oder an einem für die Jugend noch cooleren Ort: Die einen feilen an ihren Song-Texten, die anderen erklären Kindern, was Batterietechnologie oder Nanoanalytik ist, Handwerker stellen Werkzeug zur Verfügung und gewinnen junge Leute, eine Auszubildung zu beginnen. Viele Orte ohne Konsumzwang, zum Verweilen, Picknicken, Menschen beim Leben zuschauen: Sitzmöglichkeiten im wunderschönen Foyer in der tollen Architektur des LWL-Museums, auf der Terrasse vorm Theatercafé, am Aasee und überall in der Stadt. Damit jede und jeder sich willkommen fühlt.
Auch wenn reden Zeit kostet und die Empfindlichkeit groß ist: Wir brauchen den Raum für den demokratischen Streit, für die Gefühle und müssen im Kleinen beginnen. Wir müssen so sehr Haltung zeigen und gegen jede Form von Antisemitismus, diffuser Systemkritik, die sich gegen die Demokratie wendet, aufstehen. Noch vor einem Jahr hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass es Menschen mit großer Wissenschaftsskepsis gibt (schon gar nicht von abstrusen oder demokratiefeindlichen Argumenten der Impfgegner), während man selbst den mRNA-Impfstoff für einen revolutionären Durchbruch hält, auch bei der Bekämpfung von anderen Krankheiten. Demokratie war für meine Generation vielleicht zu selbstverständlich, umso mehr müssen wir jetzt für sie arbeiten und uns für die Werte einsetzen, wenn sie angegriffen werden.
Der Philosoph Josef Früchtl plädiert in seinem Buch dafür, dass Kunst und Kultur eine entscheidende Rolle zukommt, um Gefühle sinnvoll zu verwandeln und erfahrbar zu machen. Ohne Gefühle würden wir den Wert von Menschen und Dingen gar nicht wahrnehmen. Nur müssten Gefühle so artikuliert werden – wie in der Kunst -, dass ihnen eine politische Plausibilität gegeben wird. Oder wie das Stadtensemble die Demokratie feiert, zum Festival der Demokratie einlädt und Joseph Beuys zitiert „Kunst ist die letzte Möglichkeit, die Missstände und Widersprüche in der Gesellschaft zu heilen.“
Während den meisten der Kopf schwirrt von der pandemischen Krise mit ihrer Wucht – für die Gesundheit, für einzelne Existenzen, für die jungen Familien, Kinder, Jugendlichen müssen wir uns gerade jetzt Gedanken machen, wie wir in Zukunft leben wollen und wie wir uns das leisten können. Wir wünschen uns, in einem bunten Viertel zu leben, quer durch die Berufe, Generationen, Lebensstile – Kinderwagen möchte man genauso sehen wie Studierende, Junge und Alte, Singles und Paare – und wissen, wie hoch der Gentrifizierungsdruck ist, dass mehr als 30 Prozent des Einkommens für Wohnen bedeutet, dass das Geld an anderer Stelle für das Leben nicht mehr ausgegeben werden kann. Wie sind alle Bevölkerungsteile existenziell aufgestellt, wie können alle partizipieren? Es wird eine große gemeinsame Anstrengung sein, Nachhaltigkeit sozial und generationenübergreifend zu erreichen, darüber zu debattieren, was wir als Gesellschaft brauchen, die Nöte und Ängste zu hören, den Spaltungen entgegenzuwirken und doch gemeinsame Ziele zu sehen. Konflikte bergen auch innovatives, schöpferisches Potenzial. Konflikte auszutragen, darauf kommt es an.
Die großen Ziele können mit der Anstrengung aller in kleinen Schritten erreicht werden, indem wir unsere Fantasie beflügeln, um schöpferisch zu werden und aus vermeintlichem Verzicht mit Freude das Neue zu schaffen.
Was können wir von den Alten lernen, gibt es aus der Sicht der Jungen etwas, das wir nutzen können von dem, was eine andere Generation erreicht hat. Als Eltern weiß man ja, wie sehr man von den Kindern lernt. Von den Jungen können wir lernen, was es für sie heißt, die Stadt enkeltauglich zu machen. Auf unserem Weg der Veränderung ist jeder Einzelne von uns gefragt, seinen Beitrag zu leisten, herauszufinden aus der Selbstbezüglichkeit in dieser vermeintlich hoch-individualistischen Welt. „Ich halte die individualliberale Sicht für verfehlt“, so schreibt Christoph Möllers im Philosophiemagazin vom 09.09.21, „Tatsächlich können wir alleine gar nicht als Individuen existieren. Der Begriff des Individuums ergibt nur Sinn, wenn er sich auf eine Gemeinschaft bezieht.“
Bleiben wir also alle miteinander im Gespräch, mit Fragen, mit Interesse.
In unserem eigenen kleinen Leben, im Kreis von Freund*innen, Bekannten, in unserem Viertel, in unserer Stadt haben wir die Chance, diesen Diskurs zu üben und dabei um das Gute zu ringen. Dabei fühlen wir uns energetisiert wie in einem tollen Konzert. Oder schauen uns an, wie die Künstler*innen die großen Gefühle auf die Bühne bringen oder in Kunstwerke übersetzen und dabei Gemeinschaft erfahren.
Tipps zum Weiterlesen und Hören
Ich bin begeistert von diesem Podcast:
Menschenherz und Meeresboden sind unergründlich. Die Kunstvermittlerin Inès von Patow und der angehende Rabbiner Levi Israel Ufferfilge besuchen jüdische Menschen und erkunden Orte jüdischen Lebens in Münster.
https://lwlkulturstiftung.blog/2021/09/03/menschenherz/
Antonio Damasio: Wie wir denken, wie wir fühlen. Die Ursprünge unseres Bewusstseins.
Josef Früchtl: Demokratie der Gefühle. Ein ästhetisches Plädoyer.
Christian Budnik: Vertrauen als politische Kategorie in: Nachdenken über Corona. Philosophische Essays über die Pandemie. (Hg: Geert Keil und Romy Jaster)
Frank-Walter Steinmeier (Hg.): Wegbereiter der deutschen Demokratie. 30 mutige Frauen und Männer 1789-1918